58. Folge: 7 Fragen an Georg Essen
anlässlich des Erscheinens seines Buches
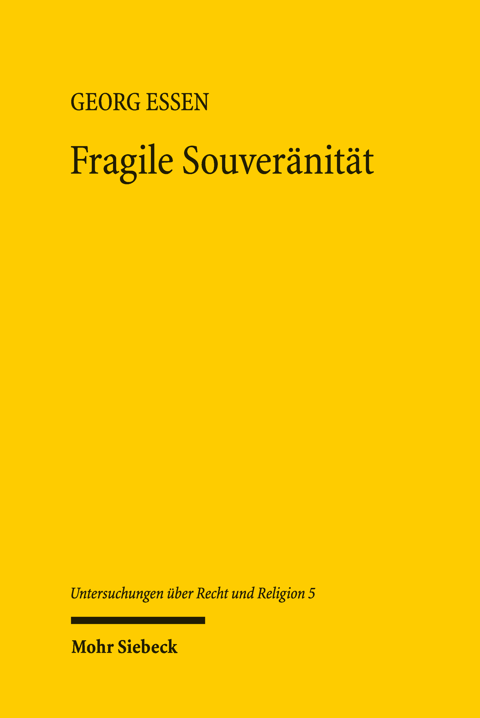
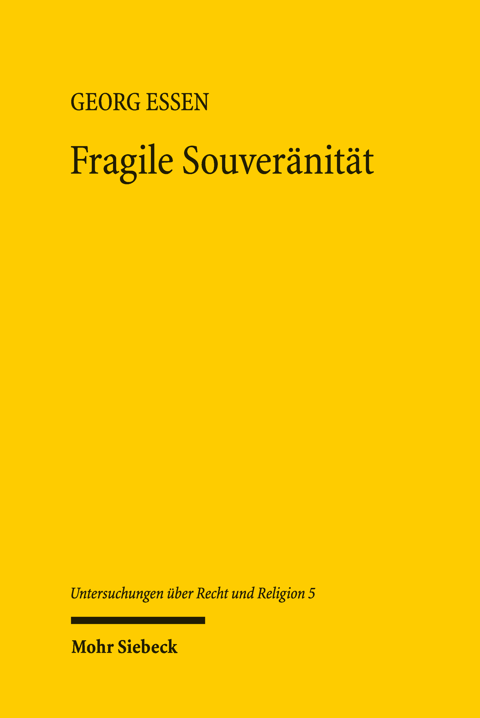
Jede Woche erscheint eine Menge neuer für Theologinnen und Theologen interessanter Bücher – es ist schwierig, hier eine Auswahl für die eigene Lektüre zu treffen. Das Münsteraner Forum für Theologie und Kirche möchte bei der Orientierung auf dem Feld der Neuerscheinungen hilfreich sein und hat deshalb 2012 die Rubrik "7 Fragen an ..." – Das MFThK-Kurzinterview gestartet.
In unregelmäßiger Folge werden bekannte und weniger bekannte Autoren von Neuerscheinungen gebeten, sieben Fragen zu beantworten – die ersten sechs Fragen sind stets dieselben, nur die siebte und letzte Frage ist eine individuelle Frage.
Die Fragen der 58. Folge beantwortet der Berliner Theologe Georg Essen zu seinem neuen Buch Fragile Souveränität. Eine Politische Theologie der Freiheit.
1. "Bücher, die die Welt nicht braucht." Warum trifft das auf Ihr Buch nicht zu?
Im Gefolge einer grundstürzenden Aufmerksamkeitsverschiebung fungiert in der politischen Moderne nicht mehr der Staat, sondern die Gesellschaft als Referenzrahmen für die in einer Politischen Theologie anvisierten Verhältnisbestimmung von Politik und Religion. Dies Einsicht wurde folgerichtig zum Ursprungsimpuls für die Begründer:innen neuer Politischer Theologien in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, wie beispielsweise für Johann Baptist Metz, Helmut Peukert, Jürgen Moltmann, Dorothee Sölle und andere. Dies musste zugleich in einer ideologiekritischen Abgrenzung zu Carl Schmitt geschehen, der beides, Politik und Religion, vom Staat her konzipiert. Zudem hatte er das Verhältnis beider auf dem Boden einer antiliberalen Staats- und Verfassungstheorie bestimmt. Damit ist der ideologiekritische Hintergrund genannt, der dafür verantwortlich ist, dass bis heute Staats- und Verfassungstheorien als ein eigentlich doch zentrales Thema der Politischen Theologie nicht mehr bearbeitet, um nicht zu sagen: sträflich vernachlässigt wurden. Diesem Desiderat begegne ich mit meinem Buch, das einen Ansatz zur Diskussion stellt, der – ohne jedoch den normativen Boden der politischen Moderne zu verlassen – eine politisch-theologische Staats- und Verfassungstheorie vorlegt.
2. Welche neuen Perspektiven eröffnet Ihr Buch?
Das Buch versteht sich, erstens und wie angedeutet, als eine interdisziplinär angelegte Staats- und Verfassungstheorie, die, in politisch-theologischer Absicht, den Legitimationsanspruch jener republikanisch-konstitutionellen Verfassungsordnung begründet, die für eine liberale Demokratie essenziell ist. Aus diesem Grunde steht der Begriff der Volkssouveränität, der als Grundlegungsprinzip für die Selbstbegründung und -bestimmung der liberalen Demokratie fungiert, im Mittelpunkt des Interesses. Diese verfassungsrechtlichen Rekonstruktionen, die, nicht von ungefähr, am Leitfaden des Freiheitsbegriffs durchgeführt werden, stoßen, zweitens, auf das Problem, dass die Staatslehre der römisch-katholischen Kirche bis heute das Prinzip der Volkssouveränität nicht anerkennt. Diese Weigerung hat zur Folge, dass die Kirche ein, zurückhaltend formuliert, gebrochenes Verhältnis zur liberalen Demokratie hat. Vor diesem Hintergrund stelle ich mit diesem Buch eine interdisziplinär ausweisbare Grundlagentheorie zur Diskussion, mit der die liberale Demokratie theologisch anerkannt werden kann. Im Mittelpunkt steht deshalb das Bemühen, die verfassungsrechtlich und demokratisch zentralen Kategorien von Autonomie, Säkularität und Repräsentation theologisch zu reformulieren. Meine Politische Theologie, stellt, drittens, den Begriff der Freiheit auch deshalb in das Zentrum, um als katholischer Theologe engagiert Position beziehen zu können angesichts der gegenwärtigen Krise der liberalen Demokratie, die als eine Krise des politischen Freiheitsbewusstseins zu deuten ist. Vor diesem Hintergrund lege ich, viertens, eine politisch-theologische und zwar näherhin anerkennungstheoretische Lesart der Lehre von der göttlichen Rechtfertigung des Menschen vor. Die politische Absicht ist, religiöse Sinnressourcen als einen gesellschaftlichen Beitrag zur Kräftigung und Stabilisierung des politischen Freiheitsbewusstseins ins Spiel zu bringen. Der Spitzensatz lautet entsprechend, dass, als ihr Sinngrund, Gott der Garant der menschlichen Freiheit ist.
3. Welche Bedeutung kommt dem Thema in aktuellen theologischen und kirchlichen Debatten zu?
Das Buch liest nicht falsch, wer es auch als ein liberal-katholisches Votum in den theologischen und kirchlichen Deutungskämpfen der Gegenwart versteht. Die römisch-katholische Kirche verweigert bis heute der autonomen Freiheit des Menschen ihre Anerkennung, auf der auch das Recht auf politische Selbstbestimmung beruht. Die Kirche hat ein gebrochenes Verhältnis zum politischen Liberalismus und zu dessen Grundprinzipien Freiheit, Gleichheit und Individualismus. So bleibt es nicht aus, dass der Katholizismus derzeit und im Globalmaßstab gesehen ein diffuses Bild abgibt, weil nicht immer klar ist, auf welcher Seite er im Ringen um den Erhalt demokratischer Verfassungsordnungen eigentlich steht: auf der Seite "illiberaler Demokratien", die gelegentlich unter dem Begriff "christlicher Demokratien" firmieren, oder aufseiten der Verteidiger:innen westlicher Freiheitswerte. Mit meiner Politischen Theologie trete ich sehr entschieden für eine innerkirchliche Kräftigung freiheitlicher Glaubenstraditionen ein. Eine glaubwürdige Verteidigerin der liberalen Demokratie kann die Kirche jedoch nur sein, wenn sie, nach "innen" gerichtet, eine Kirche der Freiheit ist. Es gilt deshalb, verschüttete, vergessene und teils ideologisch verdrängte Freiheitstraditionen des Katholizismus freizulegen und zu mobilisieren. Nur dann nämlich wird er eine gesellschaftliche Relevanz entfachen können, mit der Gott als Freiheitsgarant für das Gelingen politischer Freiheit glaubwürdig bezeugt wird.
4. Mit wem würden Sie Ihr Buch am liebsten einmal diskutieren?
Auf jeden Fall mit Kolleg:innen aus der Zunft der Theologie, den Rechts- und Politikwissenschaften sowie der Philosophie. Darüber hinaus auch mit Politiker:innen, die an religionskulturellen und -politischen Fragen interessiert sind. Ferner natürlich mit meinen Münsteraner Lehrern Thomas Pröpper, Johann Baptist Metz, Tiemo Rainer Peters und Helmut Peukert. Und schließlich wäre eine Tafelrunde mit Wilhelm von Ockham, Immanuel Kant, Ernst Troeltsch, Hans Kelsen, Hermann Krings und Hannah Arendt anregend und faszinierend. Was ist mit Carl Schmitt? Er sollte schon dabei sein, aber eher wie der am Baum gefesselte und geknebelte Barde Troubadix beim Festbankett im gallischen Dorf der Freiheitsliebenden.
5. Ihr Buch in einem Satz:
Es gilt, gesellschaftlich wie politisch, aber auch religiös wie kirchlich diesen einen Satz immer wieder aufs Neue und ebenso hartnäckig wie geduldig durchzubuchstabieren: "Freiheit ist unser und der Gottheit Höchstes." (Friedrich Schelling)
6. Sie dürfen fünf Bücher auf die sprichwörtliche einsame Insel mitnehmen. Für welche Bücher entscheiden Sie sich?
Frei nach Bert Brecht: "Sie werden lachen, die Bibel"; Harry Mulisch, 'De ontdekking van de hemel'; Thomas Mann, 'Der Zauberberg'; Robert Musil, 'Der Mann ohne Eigenschaften'; Christa Wolf, 'Kassandra', 'Medea'.
7. Die siebte und letzte Frage stammt vom Verfassungsrechtler Dieter Grimm: 7. Wie kann die verfassunggebende Gewalt dem Volk zugeschrieben werden, wenn es erst durch die Verfassung zum Volk im Sinn eines Handlungssubjekts wird?
Die Frage lässt sich, so meine ich, im isolierten Rahmen des Verfassungsrechts nicht beantworten, sondern verweist zurück auf die politischen Legitimationsquellen eines demokratischen Verfassungsstaates. Es verhält sich ja in der Tat so, dass die Zugehörigkeit zum pouvoir constituant, zur gesetzgebenden Gewalt, nicht ihrerseits verfassungsrechtlich schon vorgegeben und geregelt sein kann. Das bedeutet zugleich, dass die Einheit des "Volkes", das sich in einem gemeinsamen Willensentschluss eine Verfassung gibt, nicht vorgängig durch die Normgeltung der Verfassung selbst eingehegt ist. In dieser Konsequenz ist der Begriff des "Volkes" zwar eine vorrechtliche, aber keineswegs eine vorpolitische Gegebenheit. Denn das Volk erhebt sich zu einem politischen Handlungssubjekt in dem Akt einer freiheitlichen Selbstermächtigung, um den Staat zu gründen, in dem es in kommunikativer Freiheit und deshalb dem Gesetz unterworfen leben will. Wenn nun nach vorrechtlichen Normativitäten gefragt wird, die die verfassungsgebende Gewalt ihrerseits legitimiert, dann wäre auf das Freiheitsbewusstsein jener Menschen zu verweisen, die in einer Ordnung der Freiheit gemeinsam leben wollen. Verhielte es sich anders, wäre der Sinn dieses Staates nicht die Freiheit!